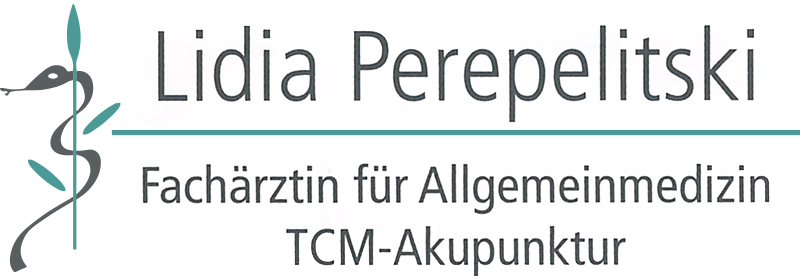Unbehandelt gefährlich: Gefäßerkrankung pAVK kann lange unerkannt bleiben. Herzstiftung informiert über Symptome, wie man Risiken der pAVK vorbeugt und wie sie behandelt wird
Jedes Jahr bekommen Tausende Menschen in Deutschland einen Beininfarkt. Dahinter verbirgt sich die sogenannte periphere Arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), auch als „Schaufensterkrankheit“ bekannt. Die pAVK ist eine Erkrankung des höheren Lebensalts mit immer enger und steifer werdenden Arterien in Beinen und Füßen, manchmal auch Armen, weil nicht mehr genügend Sauerstoff und Nährstoffe dorthin gelangen. In Deutschland sind Schätzungen zufolge zweieinhalb bis acht Millionen Bürger von der Volkskrankheit pAVK, eine Durchblutungsstörung der Becken- und Beinarterien betroffen. Etwa drei bis zehn Prozent der Bevölkerung sind in Deutschland von einer pAVK betroffen, im höheren Alter ab 70 Jahren schätzungsweise sogar 15-20 Prozent (1). Zu etwa 90 Prozent ist die Ursache der pAVK eine Gefäßverkalkung und -verengung (Arteriosklerose), also krankhafte Ablagerungen und Entzündungsvorgänge in den Gefäßen. Damit ist die pAVK Teil eines größeren umfassenderen Krankheitsgeschehens.
„Wenn sich die Gefäßerkrankung pAVK mit Schmerzen in der Wade oder an den Zehen bemerkbar macht, dann ist anzunehmen, dass auch an anderen Stellen des Körpers das arterielle Gefäßsystem, etwa am Herzen, nicht mehr ganz in Ordnung ist und eine koronare Herzkrankheit (KHK) vorliegt“, warnt die Herz- und Gefäßspezialistin Prof. Dr. Christiane Tiefenbacher, Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung. Bei einer Arteriosklerose sind die Beine in der Regel relativ spät betroffen. Die pAVK und andere Krankheiten beziehungsweise Komplikationen wie KHK, Schlaganfall und Nierenfunktionsstörungen hängen miteinander zusammen, weil die Arteriosklerose die zugrunde liegende Ursache ist. „Wer an Beinschmerzen leidet, sollte daher immer auch das Herz untersuchen lassen“, so die Chefärztin der Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Intensivmedizin am Marien-Hospital Wesel im aktuellen Herzstiftungs-Sonderdruck „pAVK“, der kostenfrei bei der Herzstiftung angefordert werden kann unter https://herzstiftung.de/bestellung
„Wer eine KHK oder bereits einen Herzinfarkt überstanden hat, wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch eine pAVK haben, auch wenn sie womöglich noch nicht spürbar ist.“ Infos zu Ursachen, Symptomen, Diagnose und Therapie der pAVK bietet die Herzstiftung auch unter https://herzstiftung.de/pavk
Vorbeugung: Wie schützt man sich vor Risiken für pAVK?
Wie bei der die KHK und anderen Krankheiten als Folge der Arteriosklerose sind typische Risikofaktoren der pAVK ein ungesunder Lebensstil durch
- ungesunde Ernährung, verbunden mit Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas) und
sowie die Risikokrankheiten
- Fettstoffwechselstörunten (veränderte Blutfettwerte, hohes LDL-Cholesterin) und
- Zuckerstoffwechselstörungen (Diabetes mellitus).
Hauptziele der Behandlung einer pAVK sind, das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen sowie Amputationen und Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall zu vermeiden. Mit einer einzelnen Maßnahme lässt sich aber ein seit Jahren laufender und aus vielen Faktoren bestehender Krankheitsprozess wie die Arteriosklerose nicht einfach stoppen. Mit dem Einsatz von Medikamenten und/oder Katheter- oder chirurgischen Verfahren zur Wiederherstellung der Durchblutung einzelner verengter oder verschlossener Gefäße ist vieles möglich. „Hauptziel ist es, Risikofaktoren prophylaktisch zu minimieren und so die Funktion der vorhandenen Gefäße so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, trotz der chronischen Gefäßerkrankung. Dafür sind mehrere Behandlungsmaßnahmen in Kombination nötig – sehr wichtig sind die aktive Mitarbeit und die Therapietreue der Betroffenen“, betont Herzstiftungs-Vorstandsmitglied Prof. Tiefenbacher.
Auch bei pAVK sehr wirksam und wichtig: Bewegungstraining
Zunächst sind die Risikofaktoren zu reduzieren: das Rauchen aufgeben, zu hohes Körpergewicht reduzieren, sich ausgewogen und gesund ernähren und sich mehr bewegen. Ein vorhandener Bluthochdruck wird medikamentös konsequent gesenkt, bei Fettstoffwechselstörungen (hohes LDL-Cholesterin) und Diabetes mellitus sind die entsprechenden medikamentösen Maßnahmen und Änderungen des Lebensstils erforderlich.
„Besonders Bewegung in Form des Gehtrainings ist sehr effektiv. Das Bewegungstraining wertet auch die aktuelle pAVK-S3-Leitlinie auf“, betont Kardiologin Prof. Tiefenbacher. Studien belegen, dass mit einem Gehtraining in den pAVK-Stadien I und II die Strecke, die schmerzfrei und insgesamt maximal zurückgelegt werden kann, zunimmt. „Empfehlenswert ist ein Gehtraining mit mindestens drei Übungseinheiten pro Woche für jeweils 30 bis 60 Minuten über mindestens drei Monate.“ Fortschritte sind schon nach dieser Zeit zu erzielen, wie Studien gezeigt haben. Ein Training in Eigenregie zu Hause – immer in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt und bei regelmäßiger Überprüfung der Effekte – ist zwar möglich, „besser ist aber eine strukturierte Übungstherapie unter Anleitung“, so Tiefenbacher. Spezialisierte Gefäßzentren bieten Geh- und Gefäßtrainings an. Regionale Gefäßsportgruppen lassen sich zum Beispiel über die Internetseiten der Deutschen Gefäßliga oder den Deutschen Behindertensportverband (DBS) finden. Geeignet sind auch Herzsportgruppen und Diabetes-Sportgruppen. „Gerade der Sport in der Gruppe, gemeinsam mit ähnlich Betroffenen und Gleichgesinnten, hat eine ungemein motivierende Wirkung, fördert den sozialen Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung“, betont die Chefärztin am Marien-Hospital Wesel. Welche alternative Trainingsformen zum Gehtraining wie beispielsweise Radfahren und Krafttraining der Beine ansonsten zu empfehlen sind, darüber informiert die Herzstiftung unter: https://herzstiftung.de/pavk
Wie macht sich eine pAVK bemerkbar?
Wie andere chronische Krankheiten auch, macht sich die pAVK mit Symptomen erst dann bemerkbar, wenn sie vorangeschritten ist. Deshalb sollten alle Patientengruppen mit einem Risiko für Arteriosklerose über die Symptomatik der pAVK gut informiert sein. Die Beschwerden lassen sich in vier Stadien (Fontaine-Kriterien) einteilen:
- Stadium I: Engstellen in den versorgenden Arterien sind vorhanden, verursachen aber noch keine oder kaum Beschwerden. Dieses Stadium ist nur mit bestimmten Untersuchungsmethoden zu erfassen.
- Stadium II: Typische Zeichen der „Schaufensterkrankheit“ (medizinisch: Claudicatio intermittens) liegen vor mit belastungsabhängigen Schmerzen beim Gehen, die zu regelmäßigen Pausen zwingen (IIa = Gehstrecke ohne Beschwerden über 200 m, IIb = Gehstrecke ohne Beschwerden unter 200 m).
- Stadium III: Ruheschmerz, häufig beginnend im vorderen Fußbereich, insbesondere nachts.
- Stadium IV: Gewebeuntergang durch die Durchblutungsstörung (Ischämie); offene Wunden entstehen, die schlecht heilen.
Schmerzen nicht nur beim Gehen, sondern auch im Liegen möglich
Zwar ist es für Beinschmerzen, die durch Durchblutungsstörungen hervorgerufen werden, typisch, dass sie beim Gehen in den Waden auftreten und beim Stehenbleiben wieder nachlassen. Allerdings kann es auch im Liegen zu Schmerzen in der Zehengegend kommen, die sich beim Aufstehen wieder abschwächen. Auch sollte man sich nicht vollkommen auf diese Schmerzbeschreibung verlassen, denn die Symptome können auch in anderen Beinabschnitten auftreten, zum Beispiel in den Oberschenkeln oder im Gesäß. „Die Lokalisation des Schmerzes ist ein Hinweis für den Ort des Gefäßproblems. Etwa der Wadenschmerz ist am häufigsten und entsteht bei Verengungen und Verschlüssen im Bereich der Oberschenkelarterien. Kommt es zu Gesäß- und Oberschenkelschmerzen bei Belastung, liegt die Durchblutungsstörung in Höhe der Beckenarterien“, erklärt die Herz- und Gefäßspezialistin im Vorstand der Herzstiftung. Neben den genannten Schmerzen in den Beinen gibt es noch weitere Symptome, die auf die Verschlusskrankheit pAVK hindeuten wie eine reduzierte Behaarung oder kältere Haut des betroffenen Beins, dessen Haut auch dünn, schuppig und leicht verletzlich sein kann. Mehr zu Symptomen unter https://herzstiftung.de/pavk
Bein- oder Fußinfarkt: Wie kommt es dazu?
Vergleichbar dem Herzinfarkt, gibt es auch den Bein- oder Fußinfarkt: Reicht die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen im betroffenen Areal nicht mehr aus, stirbt Gewebe in diesen Organen ab. Mangelt es akut an Blut im Bein, droht ein mehr oder weniger großer Beininfarkt. Es entstehen chronische Wunden, diese können sich infizieren und entzünden, Gewebe wird funktionslos und stirbt ab. „Im schlimmsten Fall muss amputiert werden. Bis heute passiert dies leider zehntausendfach pro Jahr“, sagt Prof. Tiefenbacher. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 57.000 Amputationen an Beinen oder Füßen vorgenommen, davon lassen sich über 85 Prozent auf eine pAVK oder/und einen Diabetes mellitus zurückführen (2). „Deshalb sensibilisieren wir Patienten mit einem Risiko für eine pAVK aufgrund bestehender Herz- und Gefäßleiden wie KHK, Bluthochdruck oder Diabetes, bei Beschwerden hellhörig zu werden und umgehend ihren behandelnden Hausarzt darüber zu informieren“, so Prof. Tiefenbacher.
Notfall: plötzlicher Arterienverschluss
Mitunter kann ein Gefäß plötzlich durch Blutgerinnsel oder abgelöste Plaques verschlossen werden, besonders wenn die Arterie bereits verengt ist. Ein akuter, ausgedehnter Verschluss einer Arterie im Bein oder im Arm ist immer ein Notfall – ein Notarzt sollte gerufen werden (Notruf 112). Typische Zeichen für ein solches Ereignis sind:
- starke, peitschenhiebartige Schmerzen im Bein oder im Arm
- die Haut ist blass oder bläulich verfärbt
- Taubheitsgefühl, Hitzereize werden nicht mehr wahrgenommen
- Bewegungsunfähigkeit oder -einschränkung der Gliedmaße
- Puls ist an dem Körperteil nicht tastbar
Achtung: Auf keinen Fall versuchen, die Gliedmaße zu wärmen oder zu kühlen! Die Gliedmaße wird weich gelagert oder gepolstert, bis der Notarzt eingetroffen ist. Der Verschluss sollte möglichst innerhalb weniger Stunden medikamentös, per Katheter oder per Operation entfernt und das Gefäß wiedereröffnet werden